Deutsches Gericht limitert IP-Blocking-Befugnisse der Glücksspielaufsicht
Im März 2025 hat der Bundesverwaltungsgerichtshof (BVerwG) ein Machtwort gesprochen und entschieden, dass die Glücksspielbehörde GGL nicht das Recht hat, Internetanbieter zur Sperrung von illegalen Glücksspielseiten zu verpflichten.
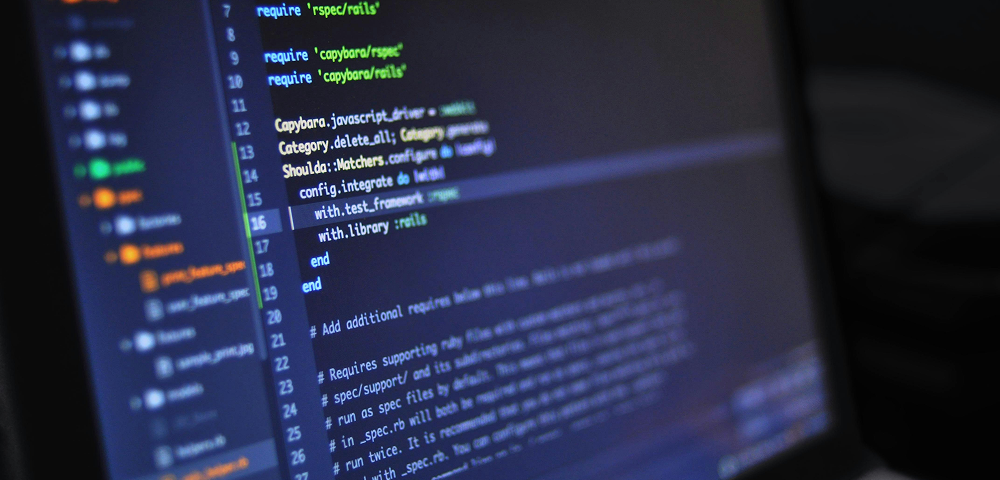
Das Urteil löst den jahrelangen Rechtsstreit endgültig auf, bei dem es schon mehrere Verfahren vor zum Teil unterschiedlichen Verwaltungsgerichten wegen der Umfangs und Reichweite der Befugnisse der Behörde gegeben hatte. Nun ist höchstrichterlich entschieden worden und die Spielregeln ändern sich - im Verhältnis zwischen Regulierungsbehörde, aber auch zu Anbietern und Nutzern.
Die Tragweite des Urteils geht dabei weit über diesen einen Fall hinaus. Denn es wird klar: Eingriffe in das Netz, in die Infrastruktur, die Daten oder den Datenverkehr sind demnach nur möglich, wenn es eine klare gesetzliche Grundlage dafür gibt. Das ist eine herbe Niederlage für die GGL, aber auch eine Zäsur für die gesamte Branche.
Welche Rolle spielt die GGL und was durfte sie bisher?
Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) wurde 2021 ins Leben gerufen, um den Online-Glücksspielmarkt zu regulieren. Zu ihrem Hauptanliegen zählte es, illegale Glücksspielangebote einzudämmen und Spieler auf den regulierten Markt zu lenken. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte die Behörde ein ganzes Maßnahmen-Paket geschnürt. Neben Bußgeldern und Werbeverboten wollte sie auch Netzsperren durchsetzen.
Doch ob und wie die GGL solche Sperren anordnen durfte, war von Anfang streitig. Kritiker warfen der Behörde vor, ihr Ziel aus den Augen zu verlieren - vor allem die Anordnung von Netzsperren sorgte für Proteste bei Providern, Juristen und Datenschützern. Mit dem Urteil ist klar: Die rechtliche Grundlage für solche Eingriffe ist von vornherein nicht so belastbar, wie die GGL angenommen hat.
Warum IP-Blocking als Mittel zum Schutz vor Glücksspiel umstritten ist
Auf den ersten Blick wirkt IP-Blocking als ein naheliegendes Instrument: Die IP-Adresse einer unerlaubten Glücksspielseite wird gesperrt und schon haben Nutzer keine Möglichkeit mehr, zuzugreifen. Die Praxis sieht allerdings anders aus.
Betreiber reagieren darauf, dass IPs gesperrt werden, indem sie schnell mal deren Adressen wechseln. Nutzer haben dagegen Sperren längst umgangen, indem sie beispielsweise VPNs oder alternative DNS-Dienste nutzen.
Auch juristisch ist IP-Blocking umstritten. § 9 Abs. 4 GlüStV verweist auf Vorschriften, die eigentlich für klassische Internetdienstleister mit eigener Infrastruktur gelten. Reseller, die selbst keine Netze haben, fallen unter die Regelung nur schwer. Kritiker sehen darin einen regulatorischen Blindgänger, der mehr Symbolpolitik als praktische Wirkung entfaltet.
Juristische Argumente des Bundesverwaltungsgerichts
Die Richter des BVerwG argumentierten klar und konsequent. Der Glücksspielstaatsvertrag benennt explizit Diensteanbieter, die Inhalte über eigene Systeme bereitstellen. Reseller, die lediglich Zugänge vermitteln, sind nicht umfasst. Eine Ausweitung der Befugnisse über allgemeine Rechtsgrundlagen sei nicht zulässig, weil die speziellere Regelung Vorrang habe
Damit machten die Richter deutlich: Wenn die Politik wirklich IP-Blocking als Instrument will, muss sie den Glücksspielstaatsvertrag ändern. Solange das nicht geschieht, dürfen Reseller keine Sperranordnungen mehr erhalten. Das Urteil schafft damit Rechtssicherheit für die Branche und zwingt die Politik, Farbe zu bekennen.
Folgen für lizenzierte und nicht lizenzierte Anbieter
Für die Anbieter hat die Entscheidung weitreichende Folgen. Access-Provider ohne eigene Netze müssen keine Maßnahmen mehr fürchten. Nutzer, die über diese Anbieter ins Internet gehen, behalten uneingeschränkten Zugang – auch zu illegalen Glücksspielseiten.
Für legale Anbieter ist das Urteil ein Rückschlag. Sie stehen im Wettbewerb mit Anbietern, die außerhalb der Regulierung operieren, oft bessere Quoten anbieten und weniger Einschränkungen kennen. Damit wächst der Druck auf die Politik, neue Wege zu finden. Laut einem neuen Bericht von Adlerslots.com sehen viele Marktteilnehmer das Urteil als Beweis dafür, dass der bestehende Rechtsrahmen zu schwach ist, um den Schwarzmarkt wirksam zu bekämpfen.
Reaktionen aus Politik, Wirtschaft und Verbraucherschutz
Die Reaktionen auf das Urteil fielen gespalten aus. Die GGL selbst gab sich pragmatisch und verwies darauf, dass ihre Host-Blocking-Strategie nicht betroffen ist. Hierbei werden Domains gezielt gesperrt, die illegale Angebote bereitstellen. Dieses Verfahren gilt als rechtlich belastbarer, ist jedoch technisch aufwändiger.
Branchenvertreter der legalen Anbieter kritisierten die Entscheidung scharf. Sie fürchten, dass Spieler verstärkt auf unregulierte Plattformen abwandern. Verbraucherschützer hingegen begrüßten die Klarheit des Urteils, mahnten aber gleichzeitig, dass die Politik nachbessern müsse. Besonders in der Diskussion: Werbeblockaden für illegale Anbieter und eine engere Kooperation mit Zahlungsdienstleistern, um Geldflüsse in den Schwarzmarkt zu unterbinden.
Europäische Vergleiche: Wie andere Länder mit IP-Sperren umgehen
Ein Blick nach Europa zeigt, dass Deutschland mit seinem zurückhaltenden Kurs nicht alleinsteht. In Großbritannien sind Netzsperren Teil eines breiteren Maßnahmenpakets, das auch strenge Lizenzauflagen und hohe Strafen umfasst. Spanien kombiniert IP-Blocking mit intensiver Marktaufsicht und massiven Sanktionen.
Andere Länder setzen stärker auf alternative Maßnahmen. In den Niederlanden etwa liegt der Fokus auf Payment-Blocking, also der Unterbindung von Transaktionen zu illegalen Plattformen. Skandinavische Länder wie Norwegen nutzen ebenfalls Host-Blocking und setzen auf Kooperation mit Banken. Deutschland steht damit vor der Frage, ob es seinen Kurs anpassen und stärker europäische Modelle übernehmen sollte.
Ausblick: Was dieses Urteil für die Zukunft des regulierten Glücksspielmarktes bedeutet
Das Urteil des BVerwG bedeutet nicht das Ende der Regulierung, sondern den Beginn einer neuen Phase. Die GGL muss ihre Strategie neu ausrichten und stärker auf Host-Blocking, Kooperationen mit Zahlungsdienstleistern und möglicherweise Werbebeschränkungen setzen. Für die Politik eröffnet sich die Chance, den Glücksspielstaatsvertrag zu modernisieren und an die digitale Realität anzupassen.
Schon jetzt ist klar, dass die Debatte über Netzsperren weitergeht. Während die GGL auf pragmatische Lösungen drängt, sehen viele Experten in der Reform des Staatsvertrags die einzige Möglichkeit, klare Verhältnisse zu schaffen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Bund und Länder bereit sind, diese Aufgabe entschlossen anzugehen.

























